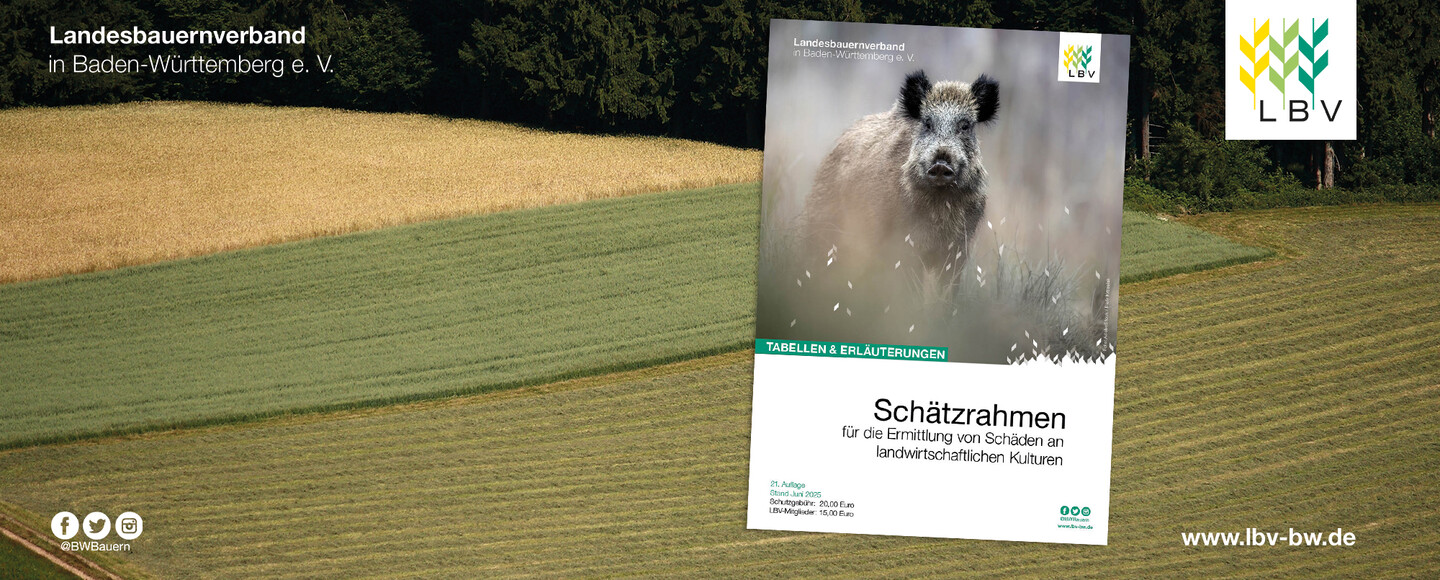Wasserkreuzkraut
Klein und mächtig giftig
In Baden-Württemberg kommen verschiedene Kreuzkräuter-Arten, auch Greiskräuter genannt, vor; insbesondere Jakobs-, Wasser- und Raukenblättriges Kreuzkraut können auch im Wirtschaftsgrünland auftreten. Untersuchungen in der Schweiz ergaben zwar Unterschiede in der Giftigkeit verschiedener Kreuzkraut-Arten, wegen der enthaltenen Pyrrolizidinalkaloide sind jedoch alle drei als sehr giftig einzustufen. Schon bei Aufnahme geringer Mengen kann es also zur Vergiftung kommen.
Vergiftungsfälle mit Futterkonserven
Besonders problematisch ist, dass die Giftigkeit der Kreuzkräuter auch im konservierten Futter (Heu, Silage) erhalten bleibt. Außerdem reichert sich das Gift im Tier an. So können auch geringe Giftdosen durch wiederholte Aufnahme von Kreuzkraut-haltigem Futter zur Erkrankung oder schlimmstenfalls zum Tod von Weidetieren führen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Tiere bis zum Erreichen einer kritischen Giftdosis unauffällig bleiben. Zu den Krankheitssymptomen gehören unter anderem Gewichtsverlust, blutiger Durchfall, häufiges Gähnen und Konditionsverlust (Pferd) oder geringere Milchleistung (Rind) und Fotosensibilität. Letztlich führt eine Vergiftung zur Schädigung der Leber.
Die tödliche Dosis Kreuzkraut ist je nach Tierart verschieden. So gelten Pferde im Vergleich zu Rindern als empfindlicher, Ziegen und Schafe als vergleichsweise unempfindlich. Beim Pferd mit 600 kg Gewicht führen 24 bis 28 kg frisches Jakobskreuzkraut zur tödlichen Vergiftung, bei einer Kuh mit 700 kg sind es 100 kg und beim Schaf mit 50 kg liegt der Wert bei 62,5 bis100 kg. Für Wasserkreuzkraut liegen bislang keine genauen Angaben zur tödlichen Dosis vor. Zu Vergiftungsfällen kommt es insbesondere bei Verfütterung von konserviertem Futter. Sowohl die Erkennbarkeit des Wasserkreuzkrauts als auch das Ausselektieren der guten Futterpflanzen ist für das Tier erschwert. Auch auf der Weide kann es zu Vergiftungen bei Futterknappheit oder Aufnahme junger Pflanzen, deren Bitterstoffgehalt noch gering ist, kommen.
Vorliebe für feuchte bis nasse Standorte
Das Wasserkreuzkraut ist eine typische Art der Sumpfdotterblumenwiesen und auf feuchten bis nassen Standorten zu finden. Es tritt auf nährstoffreichen Wiesen auf und dringt häufig bei Intensivierungsmaßnahmen und in degradierte Feuchtflächen ein, also in Flächen mit Nutzungsänderung. Dies bestätigte eine Untersuchung der Schweizer Forschungsanstalt Agroscope, die sich mit der Frage befasste, welche Faktoren für das Auftreten von Wasserkreuzkraut eine Rolle spielen. Es zeigte sich, dass ein hoher Lückenanteil im Bestand sowie Faktoren, die das Auftreten von Lücken begünstigen, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Wasserkreuzkraut erhöhen. Dazu zählen:
- stark geneigte Flächen, da hier die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung der Grasnarbe bei Mahd oder Beweidung höher ist,
- geringe Stickstoffdüngung, da auf solchen Flächen konkurrenzkräftige Arten weitgehend fehlen, die eine dichte Grasnarbe bilden und
- Änderungen in der Bewirtschaftungsintensität, die eine veränderte Bestandeszusammensetzung zur Folge haben, mit der ein höherer Lückenanteil verbunden sein kann.
Das Wasserkreuzkraut ist auch auf intensiver genutzten Flächen zu finden, was laut der Schweizer Untersuchung damit zusammenhängen kann, dass mehr Energie in die bodenanliegenden Blattrosetten als in die Stängel investiert wird. Diese werden bei einer Nutzung kaum erfasst oder beeinträchtigt. Außerdem profitiert Wasserkreuzkraut als relativ kleinwüchsige Pflanze mit einer Höhe von 15 bis 60 cm besonders von einer regelmäßigen Lichtstellung.
Verunkrautung auch im Intensivgrünland
Wasserkreuzkraut ist – ebenso wie das Jakobskreuzkraut – eine zweijährige Pflanze, die durch störende Eingriffe wie beispielsweise durch einen Schnitt mehrjährig werden kann. Es bildet ähnlich wie der Löwenzahn flugfähige Samen („Pusteblumen“) und ist hinsichtlich seiner Ausbreitung sehr effizient. Bis zu mehreren Hundert Samen pro Pflanze werden jährlich produziert, die außerdem eine sehr schnelle Keimungsrate aufweisen. In dem Schweizer Versuch waren 45 Prozent der Samen schon nach zehn Tagen gekeimt. Dies führt dazu, dass bei einer Nachsaat Wasserkreuzkraut teils schneller keimt als die gesäten Arten. Die Keimfähigkeit der Samen im Boden ist außerdem mit mehr als zehn Jahren sehr lang. Sind also Pflanzen im Bestand und damit auch Samen im Boden vorhanden, kann es im Fall von Lücken immer wieder zu neuer Keimung und somit zur weiteren Ausbreitung kommen.
Lücken sofort wieder schließen
Wie auch bei anderen unerwünschten Pflanzen gilt es in erster Linie, das Auftreten des Wasserkreuzkrauts durch eine dichte Grasnarbe zu vermeiden. Entstandene Lücken sollten rasch wieder geschlossen werden. Taucht Wasserkreuzkraut dennoch im Bestand auf, muss eine frühzeitige Einzelpflanzenbekämpfung durch Ausreißen oder Ausstechen bei einer Pflanzenhöhe von etwa 15 bis 20 cm erfolgen, wobei Handschuhe zu tragen sind. Der Unkrautstecher der Firma Fiskar (Handelsname: Fiskars Lawn-Weed-Puller) ist, was Arbeitsleistung und Narbenverletzung betrifft, besser als der Ampferstecher. Die Pflanzen sollten anschließend unbedingt von der Fläche entfernt werden, da eine Nachreifung von Samen oder eine spätere Aufnahme durch Tiere möglich ist. Mechanische Einzelpflanzenmaßnahmen sind allerdings nur bei geringem Vorkommen (weniger als fünf Pflanzen je Quadratmeter) zu empfehlen, da sonst die Keimungsrate in den neuen Lücken zu hoch ist. Bei mehr Pflanzen im Bestand sind andere Maßnahmen nötig.
Im Gegensatz zum Jakobskreuzkraut (Empfehlung dort: zwei Schnitte jährlich jeweils zu Blühbeginn) kann das Wasserkreuzkraut über einen Schnitt nicht verdrängt werden, da es schon 20 Tage nach einer Nutzung neue Blüten treibt. Laut bisheriger Kenntnis gilt, insbesondere bei artenreichen Flächen, bei denen ohnehin Futter vergleichsweise geringer Qualität wächst, eine einmalige späte Mahd im September als empfehlenswert. Das vergleichsweise kleinwüchsige Wasserkreuzkraut erfährt durch die späte und einmalige Nutzung eine Beschattung durch die anderen Pflanzen, wodurch es geschwächt wird. In der Folge kommen weniger Pflanzen zur Bildung von Stängeln und somit von Blüten. Weiteres Aussamen einzelner blühender Pflanzen ist zusätzlich durch manuelles Ausreißen zu verhindern. Auch der Einsatz der üblichen, gegen Zweikeimblättrige im Grünland anwendbaren Herbizide ist möglich, sofern es sich nicht um Naturschutzflächen oder Flächen mit Auflagen handelt, die eine Herbizidanwendung verbieten.
Zu beachten ist bei jeglicher Regulation, dass nach einer Maßnahme eine Nachkontrolle auf Wiederaustrieb oder Neukeimung erfolgen sollte oder auch eine Wiederholung der Maßnahme notwendig sein kann. Generell zeigen bisherige Untersuchungen, dass es bislang keine zufriedenstellende Lösung zur langfristigen Kontrolle des Wasserkreuzkrauts gibt, was in dessen hoher Keimungsrate und langen Keimfähigkeit begründet ist.
Kein Verkauf befallener Partien
Was kann man mit den Aufwüchsen tun, wenn Wasserkreuzkraut enthalten ist? Heubereitung und der Verkauf des Heus ist nicht ohne Weiteres möglich. Zu beachten ist, dass Futtermittel, die die Gesundheit von Tieren schädigen, weder verfüttert noch verkauft werden dürfen. Damit scheiden die Verwertung und der Verkauf als Futterheu aus.
Eine alternative Verwertungsmöglichkeit ist die Vergärung in der Biogasanlage, da dies die Samenkeimfähigkeit von Jakobskreuzkraut – ebenso wie vorheriges Silieren – aufhebt. Es ist davon auszugehen, dass dies auch für das Wasserkreuzkraut gilt. Was bleibt also zu tun übrig? Rechtzeitig reagieren und nicht erst warten bis ein hoher Prozentsatz an Pflanzen im Bestand erreicht ist: Rasche und frühzeitige Bekämpfung ist die beste Problembehandlung.
Was festzuhalten bleibt
Das Wasserkreuzkraut tritt nicht nur auf Extensivflächen, sondern auch auf intensiverem Grünland auf. Mit den vielen flugfähigen Samen kann es sich rasch ausbreiten, sofern es lückige Grasnarben zur Keimung findet. Das Wasserkreuzkraut lässt sich – im Gegensatz zum Jakobskreuzkraut – über einen Schnitt zu Blühbeginn nicht verdrängen. Besser ist bei hohem Aufkommen eine einmalige jährliche Mahd im September.
Autor: Dr. Melanie Seither, LAZBW Aulendorf