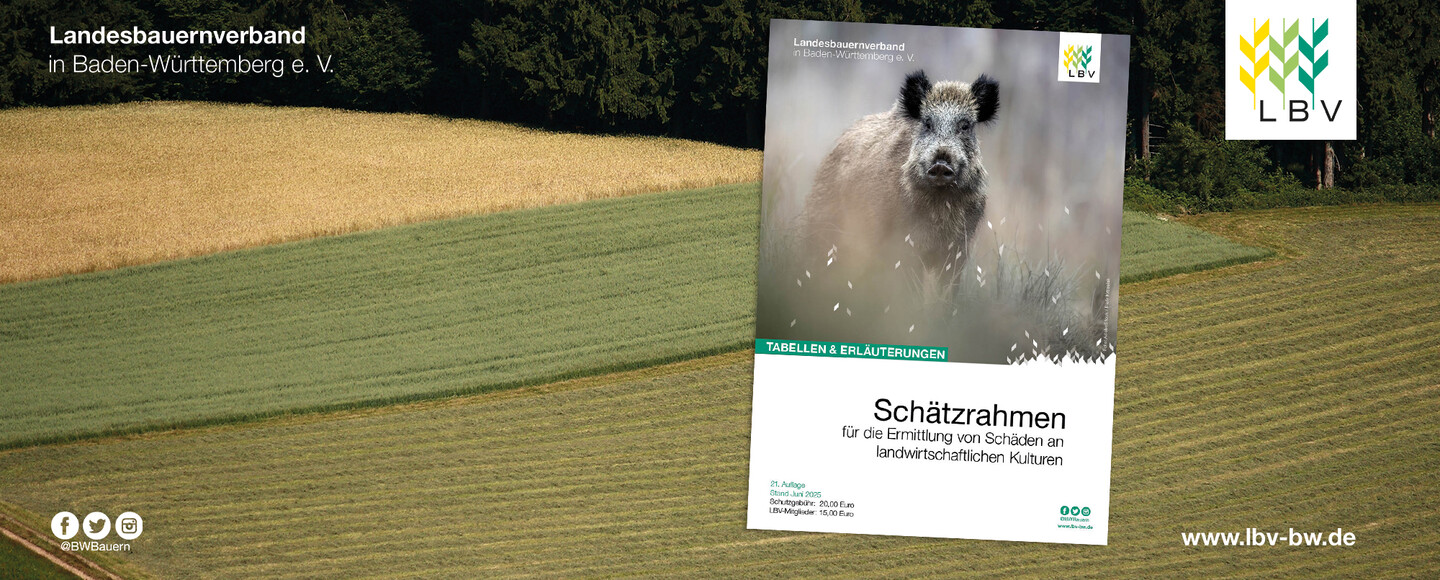Volksbegehren Artenschutz
Hopfenpflanzerverband: Es geht ans Bier
Die Tettnanger Hopfenpflanzer zeigen sich besorgt um die Initiative zweier Stuttgarter Imker, die vergangene Woche den Zulassungsantrag für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ beim Innenministerium eingereicht haben.
Sie sehen darin brutale Folgen und das "Aus" für viele landwirtschaftliche Betriebe und tausender Hektar Anbaufläche am Bodensee und in ganz Baden-Württemberg. Denn es drohe laut den Hopfenpflanzern...
- ... das sofortige Aus jeglichen Anbaus in Landschaftsschutzgebieten ab 2025 (Stichwort komplettes Verbot von Pestiziden in Schutzgebieten). Im Obstbau am Bodensee sind allein laut Obstregion rund 3000 Hektar (ha) betroffen (ca. 1/3 der Anbaufläche), im Hopfenbau rund 500 ha (ebenfalls 1/3 der Anbaufläche).
- ... der Totalverlust ganzer Ernten, bei heute bereits bestehenden Indikationslücken und bei wie geplant nur noch 50 Prozent zur Verfügung stehender Pflanzenschutzmittel ab 2025
- ... das Abwandern von langjährigen Kunden national und international sowie der Ersatzbezug aus anderen Anbauregionen und Ländern
- ... der Zwang zur Änderung von erfolgreichen und langjährigen Bierrezepturen (die Sorte Tettnanger wird nur in Tettnang angebaut) bei Brauereien
- ... der gesetzliche Zwang (25 Prozent Ökoanbau bis 2025, 50 Prozent bis 2035) zum Ökoanbau, ohne vorhandene Kunden & Nachfrage (aktuell rund ein Prozent Ökohopfennachfrage national und international)
- ... der gesetzliche Eingriff in Eigentums- und Vertragsrechte. Langjährige Pacht- und Hopfenlieferverträge bis 2030 werden Makulatur.
- ... der gesetzliche Eingriff in langjährige Investitions- und Kapitalverpflichtungen der Betriebe.
- ... in Folge der Verlust von Kulturlandschaft am Bodensee sowie die Insolvenz und Pleite von über viele Generationen wirtschaftender Familienbetriebe.
Das angestrebte Volksbegehren gehe völlig an der Realität vorbei, ist für die Betriebe bei größter Bereitschaft nicht erfüllbar und würde das Ende großer Teile der Produktion von Sonderkulturen in Baden-Württemberg bedeuten. Die hopfenbauenden Betriebe in und um Tettnang sind zum Dialog bereit. Bereit für Vorschläge und Verbesserungen zum Schutz der Bienen und derArtenvielfalt.
"Aber bitte machbar, mit Augenmaß und ohne Existenzgefährdung generationsübergreifend wirtschaftender Familienbetriebe in Baden-Württemberg", wie es in dem Brief heißt.
Mehr zum Hopfenanbau
Im mit Weltruf versehenen Hopfenanbaugebiet Tettnang (=Hopfenbau in BW) kultivieren derzeit 128 Hopfenpflanzerfamilien auf einer Fläche von 1438 ha (= knapp 2,5 Prozent der weltweit 60.000 ha Hopfenbau) 23 verschiedene Hopfensorten für die nationale und internationale Brauwirtschaft. Die jährliche Erntemenge von ca. 2.250 t bis 2.500 t kommt zu rund 25 Prozent bei meist mittelständischen Brauereien in Deutschland, hauptsächlich in Bayern und Baden-Württemberg zum Einsatz. Rund 75 Prozent der Erntemenge geht in knapp 100 Länder dieser Erde und findet zumeist Verwendung in Premium- und Spezialbieren. Braumeister in aller Welt schätzen „das Grüne Gold“ der Montfortstadt zur Verfeinerung Ihrer Bierspezialitäten im Premiumbereich. 50 Prozent der Anbaufläche besteht aus der gebietsprägenden und hochfeinen Landsorte Tettnanger, die so nur in Tettnang angebaut wird.
Wenig Nachfrage nach Öko-Hopfen
Ein Betrieb der 128 Betriebe im Anbaugebiet Tettnang (<1 Prozent) wirtschaftet derzeit nach ökologischen (Demeter) Grundsätzen. In ganz Deutschland sind es <15 Betriebe von 1097 Hopfenbaubetrieben (gut 1 Prozent aller Betriebe). Damit ist die Nachfrage nach Ökohopfen, bei ganz leicht steigender Nachfrage, bedient. Der Hopfenbau in Deutschland und in Tettnang sieht sich seit mehreren Jahren mit einer steigenden Nachfrage konfrontiert, die in der Hauptsache auf der weltweiten Craft Beer Bewegung begründet ist. Dies sind neue, kleinere, mittelständische Brauereien mit spät und stark gehopften Bieren. Die Hopfenbaubetriebe reagieren darauf mit langjährigen Pachtverträgen bei Verpächtern und mit langjährigen Vorkontrakten mit Hopfenhandelshäusern, die seit längerem umfangreiche Lieferverpflichtungen bis ins Jahr 2030 vorsehen.
Pflanzenschutz für braufähigen Hopfen
Qualitätshopfen kann den Brauereien nur mit ausreichend zur Verfügung stehenden Pflanzenschutzmitteln bereitgestellt werden. Gleichzeitig verliert der Hopfenbau, wie viele andere Kulturen, aufgrund strenger Zulassungsbestimmungen von Jahr zu Jahr Wirkstoffe und damit Pflanzenschutzmittel. Produziert wird nach den Prinzipien des integrierten und kontrollierten Anbaus. Dies bedeutet nicht nach Vorsorgeprinzip, sondern nach Schadschwellen. Das heißt nach Warnaufruf von staatlichen und privaten Stellen wird gezielt behandelt (Stichwort soviel wie nötig, so wenig wie möglich). Denn alles Andere würde die Umwelt und den Geldbeutel des Anwenders unnötig belasten. Sowohl im konventionellen wie ökologischen Anbau stellen Schwefel- und Kupferpräparate wichtige Pflanzenschutzpräparate dar.
Pflanzenschutz per se ist heute bereits für viele landwirtschaftliche Betriebe äußerst schwierig, weil aufgrund der wenigen zur Verfügung stehenden Wirkstoffe kein vernünftiges Resistenzmanagement mehr möglich ist, ganz im Gegensatz zu vielen Ländern und Mitbewerbern weltweit. Behandelt wird in der Regel einmal gegen Läuse und Spinnmilben, je nach Witterungsverlauf (Feuchtigkeit und Temperatur) fünf bis acht Mal gegen Pilzkrankheiten.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden Schutzgebiete (u.a. Landschaftsschutzgebiete) massiv ausgeweitet. In diesen Gebieten findet aktuell ein Großteil der Produktion von Hopfen, Obst, Wein… am Bodensee unter eingeschränkten, aber noch praktikablen Bedingungen statt.
Autor: Hopfenpflanzerverband Tettnang