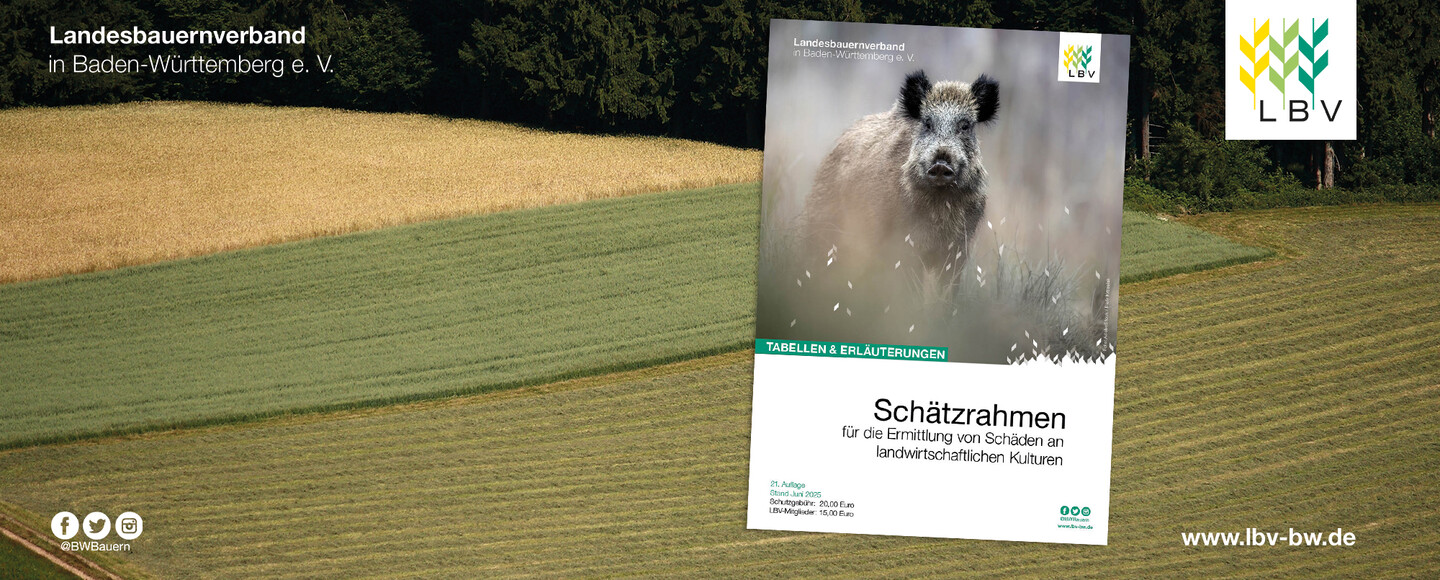DBV-Erntepressekonferenz
Getreideernte ist durch Dürre geprägt
„Die Getreideernte fällt von Region zu Region sehr unterschiedlich aus. Kleinste Unterschiede in der Bodengüte und der Wasserversorgung machen sich deutlich in den Erträgen bemerkbar“, kommentierte DBV-Präsident Joachim Rukwied das diesjährige Ergebnis der Getreideernte.
Die einzelnen Kulturen wurden nach Einschätzung des DBV in folgenden Mengen und Qualitäten geerntet:
Die Anbaufläche von Winterweizen wurde erneut leicht um knapp zwei Prozent auf 3,2 Millionen Hektar ausgedehnt und ist damit die bestimmende Getreidesorte auf Deutschlands Feldern. Im übrigen Bundesgebiet, vor allem in der Mitte Deutschlands, hat der Winterweizen offensichtlich stark unter der Trockenheit gelitten. So liegen die Weizenerträge mit durchschnittlich 7,6 Tonnen pro Hektar zwölf Prozent unter dem Vorjahr. Die Erntemenge wird vor diesem Hintergrund 24,6 Millionen Tonnen betragen und damit das Vorjahresergebnis um 2,8 Millionen Tonnen unterschreiten. In Schleswig-Holstein stehen noch zwei Drittel des Weizens auf dem Halm und müssen gedroschen werden. Die Qualitäten fallen sehr unterschiedlich aus. Die sogenannten Fallzahlen – ein Kriterium zur Bestimmung der Backqualität – erreichen angesichts der guten Witterungsbedingungen in der Erntezeit die geforderten Werte. Die Proteingehalte, die ebenfalls darüber entscheiden, ob Weizen als Brot- oder Futterweizen Verwendung findet, fallen dagegen in einigen Regionen, zum Beispiel im Süden Deutschlands sowie in Niedersachsen und im Rheinland, recht niedrig aus. Weizen mit niedrigen Proteingehalten eignet sich nicht für die Brotherstellung und kann nur mit Preisabschlägen als Futtergetreide vermarktet werden.
Die Ernte der Wintergerste, die von allen Getreidearten als erste gedroschen wird, ist abgeschlossen. Entgegen der wetterbedingten Erwartungen überraschten die erzielten Erträge. Mit 7,3 Tonnen pro Hektar liegt die Ertragsleistung der Wintergerste im Bundesdurchschnitt knapp sechs Prozent unterhalb des Jahres 2014; der Mittelwert der vergangenen Jahre wird sogar um neun Prozent übertroffen. Ein Teil der Ertragsminderung wird über die Ausweitung der Anbaufläche auf 1,26 Millionen Hektar (+ 2,4 Prozent gegenüber 2014) kompensiert, so dass die deutschen Bauern 2015 rund 9,2 Millionen Tonnen Wintergerste ernteten. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um drei Prozent bzw. rund 320.000 Tonnen Wintergerste.
Der Anbau von Sommergerste hat 2015 im Vergleich zu 2014 um mehr als sieben Prozent auf 371.000 Hektar zugenommen. Vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein wurde der Anbau ausgedehnt. Trotz dieser Ausweitung verfehlte die diesjährige Erntemenge in Höhe von knapp 2 Millionen Tonnen das Vorjahresergebnis um fast fünf Prozent. Zurückzuführen ist dies auf die deutlich geringeren Erträge. Diese unterschreiten mit 5,3 Tonnen pro Hektar das Vorjahresergebnis um mehr als elf Prozent.
Die Ernte von Roggen fiel in diesem Jahr mit insgesamt 3,2 Millionen Tonnen deutlich niedriger aus als im Vorjahr (2014: 3,85 Millionen Tonnen). Bei einer nahezu konstanten Anbaufläche von 623.100 Hektar (2014: 629.900 Hektar) ist der Rückgang der Erntemenge um 15 Prozent vor allem auf die niedrigeren Hektarerträge von 5,2 Tonnen zurückzuführen. Besonders stark eingebrochen sind die Erträge in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wo Landwirte Ertragsminderungen von mehr als 20 Prozent verzeichnen mussten. In Niedersachsen und Bayern sind die Erträge gegenüber 2014 um bis zu 15 Prozent gesunken. Da Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wichtige Roggenanbauregionen sind, spiegeln sich diese deutlichen Mindererträge im gesamtdeutschen Ernteergebnis wider.
Beim Winterraps sind die Anbaufläche und die Erträge in allen Regionen Deutschlands in Relation zum vergangenen Jahr zurückgegangen. Mit rund 1,3 Millionen Hektar wurden in 2015 knapp 8 Prozent weniger Winterraps angebaut. Hinzu kommen um 13 Prozent niedrigere Erträge in Höhe von 3,9 Tonnen pro Hektar. Die diesjährige Rapsernte wird daher mit nur 5 Millionen Tonnen das Vorjahresergebnis um 1,25 Millionen Tonnen verfehlen. Ursächlich hierfür ist neben der Trockenheit das Verbot insektizider Beizmittel, die die jungen Rapspflanzen vor mit anderen Mitteln nur schwer oder gar nicht bekämpfbaren Schädlingen schützen.
Ernte von Mais, Zuckerrüben und Grünland im Herbst Die Trockenheit in den letzten Wochen bereitet vor allem den Landwirten mit Mais- und Zuckerrübenbeständen große Sorgen. Sowohl Mais als auch Zuckerrüben befinden sich noch in der Wachstumsphase und benötigen dringend Wasser, um ausreichende Erträge zu bilden. Regional lassen die Maisbestände bereits jetzt erkennen, dass selbst bei kurzfristig einsetzenden Niederschlägen keine Erholung der Kulturen zu erwarten ist. Für die Tierhalter kommt verschärfend hinzu, dass die anhaltende Trockenheit auch den Aufwuchs von Grünland regional stark verminderte und einen üblichen dritten Schnitt des Grünlandes nicht ermöglichte. Um eine ausreichende Futtergrundlage für den Winter zu erhalten, ist davon auszugehen, dass einige Körnermaisbestände bereits vor der Abreife als Silomais zur Fütterung geerntet werden.
Getreidemärkte unter Druck
Das in der Ernte stetig steigende Angebot erzeugt weiterhin Druck auf die Terminmarktnotierungen und somit auf die Erzeugerpreise. Für eine Tonne Wintergerste erhalten Erzeuger aktuell 130 Euro bis 150 Euro, die Tonne Winterweizen erlöst je nach Qualität 145 Euro bis 175 Euro. Obwohl auch in der EU-28 eine deutlich reduzierte Erntemenge von voraussichtlich knapp 302 Millionen Tonnen (2014: 329 Millionen Tonnen) zu erwarten ist, wird bisher keine Preisverbesserung erkennbar. Dies liegt an den Rekordernten des vergangenen Jahres und der guten Versorgungslage. Der deutliche Rückgang der Erntemenge in der EU-28 ist neben einer geringeren Weizenernte (minus 9,3 Millionen Tonnen) vor allem auf eine deutlich niedrigere Maisernte zurückzuführen (Schätzung: minus 12,3 Millionen Tonnen). Sollten sich die Prognosen für die Maisernte im Herbst bestätigen, könnte die Nachfrage nach Futtergerste und Futterweizen steigen. Preiserhöhungen sind somit möglich.
Autor: Deutscher Bauernverband