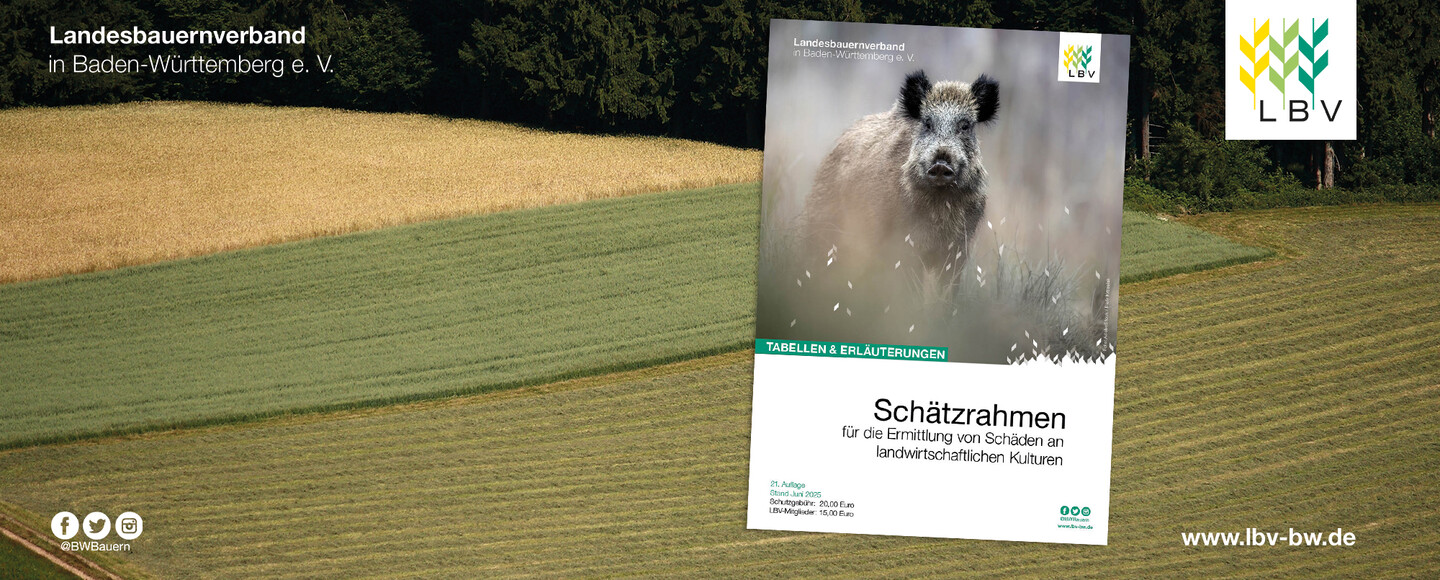KBV Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems
Es muss anders werden, wenn es besser werden soll
Bauernverbandsvorsitzender Klaus Mugele nahm beim Bauerntag die Gelegenheit wahr, den zahlreich vertretenen Abgeordneten aus allen Parteien darauf hinzuweisen, was sich aktuell verändern muss. „Denn es muss anders werden, wenn es besser werden soll“, wiederholte Mugele mehrmals vor den rund 500 Teilnehmern in der Mehrzweckhalle Wolpertshausen.
Mehrfach haben Politiker dazu aufgerufen, sich der drohenden Spaltung unserer Gesellschaft entgegen zu stellen. Mugele kann nicht erkennen, dass diese Appelle wahrgenommen worden sind. „Im Gegenteil, die Schärfe hat zugenommen, Unverfrorenheit und Rücksichtslosigkeit in den Diskussionen sind regelrecht eskaliert.“ Im Wirrwarr der Diskussionen gehe jegliche Orientierung verloren und es werde dem Extremismus Vorschub geleistet. Deshalb rief der Vorsitzende dazu auf, auch der Diffamierung der Bauern entschieden entgegenzutreten.
Die Bauern haben sich immer wieder gewandelt und verändert. Daran erinnerte Mugele auch im Rückblick auf 70 Jahre Bauernverband. Im Februar 1947 wurden in den damaligen Landkreisen des heutigen Verbandsgebietes die Bauernverbände gegründet. Wandel und Veränderung werden weiterhin notwendig sein, sagt Mugele voraus. „Wir sind mittendrin, innerverbandlich intensiver als nach außen wahrgenommen wird.“
Gut gemeint, aber nicht gut gemacht
Zu den Dingen, die anders werden müssen, zählt Mugele Projekte des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, die zu Änderungen führen sollen. Speziell nannte er die Charta für Landwirtschaft oder die umfangreichen Konzepte für das Tierwohl und das jüngst veröffentlichte Grünbuch. „Es genügt nicht, alle mögliche Betroffene anzuhören und die Statements kommentarlos zusammenzuschreiben“, bemängelt Mugele. Einen sehr vernünftigen Ansatz sieht der Bauernverband dagegen in dem vom Wissenschaftlichen Beirat vorgelegten Gutachten, das einen gesamtgesellschaftlichen Grundkonsens zur künftigen Tierhaltung fordert. Dazu gehöre die Abkehr von einseitigen Forderungen der Tierschützer und -rechtler hin zum respektvollen Umgang, um auf Augenhöhe die Ansprüche aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen.
Die Aktivitäten und Seminare des vom Bauernverband angebotenen Projekts „Klassenzimmer Bauernhof“ stellte Andrea Bleher vor. Sie führte die Notwendigkeit dieses Projekts vor Augen und warnte: „Wenn wir es nicht schaffen, der nächsten Generation ein Bild der Landwirtschaft zu vermitteln, das der Realität entspricht, werden uns die Probleme über den Kopf wachsen.“ Das Thema Ernährung wird in der Öffentlichkeit überhöht, meinte Werner Balbach, Leiter des Landwirtschaftsamtes im Kreis Schwäbisch Hall. „Es nimmt zum Teil religiöse Züge an.“
Landwirtschaft und Ernährung stellte Professor Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg in den Mittelpunkt seines Vortrags. Der Kulturwissenschaftler sieht hier Produzentenkonfusion und Verbraucherverwirrung. Er selbst wisse schon nicht mehr, was er im Supermarkt kaufen soll. „Keiner weiß, was der Kunde in Zukunft will und wie sich die landwirtschaftlichen Betriebe aufstellen sollen, um bestehen zu können.“
Die vorherrschende Verwirrung veranschaulichte er am Beispiel des Fleischsalats. Er stößt nach einer Umfrage unter Studentinnen auf nahezu null Akzeptanz, weil sie ihn für absolut ekel- und grauenhaft halten. Dagegen ist der Fleischsalat bei Studenten nach wir vor beliebt. Sie essen ihn gelegentlich ganz gerne. „Inzwischen aber mit schlechtem Gewissen, wegen der Umwelt und der Tiere“, räumt der Professor ein. Tatsächlich schnitt bei einer Untersuchung der Stiftung Warentest mehr als die Hälfte von 24 Fleischsalaten mit dem Prädikat gut ab. Die Marken der Discounter schnitten besonders gut ab.
Laufend neue Trends in der Ernährung
Für Verbraucher und Produzente war früher alles berechenbarer und einfacher. Heute kann der Trend bereits wieder umgeschlagen sein, bevor das Produkt die Marktreife erlangt hat. Nur kurze Zeit behaupteten sich beispielsweise aromatisierten Bieren, Burger aus dem Toaster oder Bubble-Tea auf dem Markt. Die Ernährung ist zur Mode geworden, erklärt Hirschfelder das Phänomen. „Für die Produzenten und ihre Kalkulation ist diese Mode eine schwierige Sache geworden. Noch stärker kann davon die Landwirtschaft betroffen sein. Denn ein Bierproduzent kann seine Produktion schneller als ein Weinproduzent umstellen.“ Was die Menschen in Zukunft allerdings wirklich essen werden, darauf will sich der Professor nicht konkret festlegen. „Die Geschichte der Prognostik ist die Geschichte ihres Nicht-Eintreffens“, lautet seine Begründung. Zumindest könne man darüber nachdenken, ob in 25 Jahren noch Hackfleisch im Handel ist. Bei einem Anteil von 70 Prozent Single-Haushalten allein in München stelle sich die Frage, ob künftig überhaupt noch die Fähigkeiten vorhanden sein werden, rohes Fleisch zuzubereiten. Viele junge Leute mögen dessen Geruch schon heute nicht und kaufen das Fleisch lieber verarbeitet, schildert der Wissenschaftler seine Erfahrungen.
Qualität stimmt – Vertrauen stimmt nicht
Den Lebensmitteln in Deutschland attestiert Prof. Hirschfelder eine Qualität und Sicherheit, wie sie noch nie vorhanden war. „Dreiviertel der Welt beneiden uns darum.“ Es handelt sich um keine Qualitäts- sondern um eine Vertrauenskrise. Das müsse in der Kommunikation mit den Verbrauchern berücksichtigt werden. „Das unglaubliche Misstrauen gegenüber dem Lebensmittelbereich ist eine erstaunliche Sache, aber ein Tatsache“, sagt Hirschfelder. Seine Schlussfolgerung lautet: Der Konsument hat kein Vertrauen und will etwas anderes, weiß aber in der Summe nicht genau was. Er hat eine andere Logik als der Produzent. Der Verbraucher denkt an die Verzehrsituationen. Deshalb müssten in der Kommunikation die Landwirte den Spieß umkehren und nicht allein aus ihrer Sicht heraus argumentieren sondern darauf achten, wie die Verbraucher ticken.
Zeitenwende
Die Verunsicherung der Verbraucher sei auch deshalb so groß, „weil wir uns an der Wende vom Industriezeitalter zu einem neuen, digitalen, globalen und lebensstilorientierten Zeitalter befinden“. Menschen kaufen regional nicht aus politischer Überzeugung, sondern weil sie in einer globalisierten Welt Sicherheit brauchen, klärte der Kulturwissenschaftler auf. Im Nahrungsmittelbereich sei aber auch das Billigsegment keinesfalls tot. „Im Gegenteil, bei der nächsten Wirtschaftskrise sei es stärker da, als je zuvor“, prophezeit Prof. Hirschfelder.
Nach einer neuesten Zukunftsstudie steht die große Masse hinter den Landwirten. Im Hinblick auf Ängste vor Naturkatastrophen sei man in Europa sehr gut aufgehoben. „Am allerbesten in Hohenlohe“, ergänzte der Wissenschaftler. „Die Naturgunst dieser Landschaft und seine Bevölkerung sei das Pfund, mit dem die Bauern wuchern können“, machte Hirschfelder den Landwirten Mut. „Wenn Sie eine Aktiengesellschaft wären, würde ich versuchen, Aktien von Ihnen zu kaufen“, bekannte er zum Schluss seines kurzweiligen und unterhaltsamen Vortags.
Autor: Gerhard Bernauer