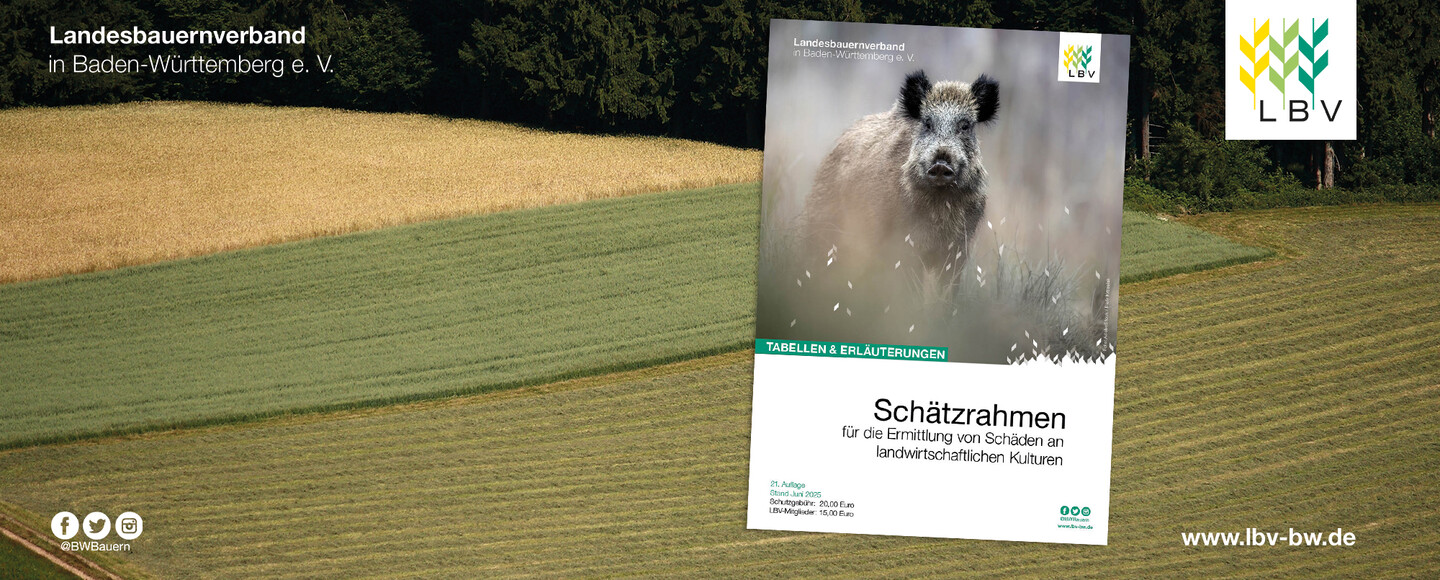Kreisbauerntag Esslingen
Am liebsten mit Apps Kühe melken
„Versuchen Sie, Ihren Betrieb für den Nachwuchs attraktiv zu gestalten. Manche jungen Leute würden am liebsten mit Apps Kühe melken. Mit der Gabel ausmisten will keiner mehr. Wenn Ihnen das gelingt, hat die Landwirtschaft eine gute Zukunft!“ ist Prof. Dr. Enno Bahrs überzeugt. Das erklärte der Agrarökonom von der Universität Hohenheim beim Kreisbauerntag Esslingen am vergangenen Samstag in Dettingen/Teck.
Bahrs lässt zu Beginn kleine Handsender verteilen. So sorgt er beim Publikum für Überraschung und Interesse zugleich. Die Teilnehmer des Bauerntages können den Vortrag zu „Wettbewerb zwischen Markt und Gesellschaft“ durch ihre Antworten auf Fragen des Hohenheimer Professors mitgestalten. Dieser „Publikumsjoker“ sticht fast immer.
Emotionen beim Boden
Der Wert des wichtigsten Produktionsmittels, des Bodens, wird „meistens emotional“ diskutiert. Da überrascht es manchen im Saal, jedoch nicht den gewieften Professor, dass gut ein Drittel der Abstimmenden Boden „am stärksten“ wegen „hoher eigener Liquidität“ kaufen, weniger wegen dem geringen Zinsniveau oder hohen Ertragserwartungen. Die Einkommens- und Liquiditätsunterschiede sind nun einmal so riesig wie die Standortunterschiede. Hier zeigt sich unter anderem der mit rund zwei Dritteln im Bundesvergleich mit rund der Hälfte überdurchschnittlich hohe Anteil an Nebenerwerbsbetrieben.
Kostenminimierer oder Erlösmaximierer
43 Prozent der Zuhörer zählen sich als Landwirt in die Kategorie der Kostenminimierer, 37 Prozent verstehen sich als Erlösmaximierer. Im Bundes- und internationalen Vergleich die Kosten zu minimieren und die Kostenführerschaft anzustreben, ist in Baden-Württemberg wegen der Standortnachteile schwierig.
Die topografischen Bedingungen und die kleinteilige Agrarstruktur erfordern durchschnittlich mehr Arbeitszeit und höhere Kosten als in anderen Regionen. Beispielsweise beträgt der Produktionskostenvorteil bei einer Parzelle mit fünf gegenüber einer mit einem Hektar im Winterrapsanbau bei einer Mechanisierung mit 120 kW rund 150 Euro je Hektar.
Größe und Strukturen wirken
Große Betriebe erzielen nach Auswertungen der deutschen Testbetriebsstatistik durchschnittlich über 400 Euro je Hektar Grundrente, kleine Betriebe weniger als minus 400 Euro je Hektar. Wie Bahrs erklärt, sind bei der Grundrente die Entlohnung der eigenen Arbeit und des investierten Kapitals bereits berücksichtigt. Sonderkulturbetriebe mit ihrer durchschnittlich geringeren Fläche haben erheblich höhere Grundrenten als andere landwirtschaftliche Kulturen. Veredelungsbetriebe wiederum erzielen im Durchschnitt höhere Grundrenten als Betriebe mit Acker- oder Futterbau. Die Grundrente juristischer Personen in den neuen Bundesländern ist rund 100 Euro je Hektar höher als von Personenunternehmen. Bei diesen Auswertungen aus der deutschen Testbetriebsstatistik zeigt sich die Wirkung von Größe und Strukturen auf den Gewinn.
Da stellt sich den interessierten Zuhörern die Frage, ob die Vorteile in der Flächengröße angesichts des technischen Fortschritts in der Zukunft erhalten bleiben. Der Agrarökonom wirft das Bild des Prototypen eines autonomen Feldroboters der Firma Bosch an die Wand. Danach fragt er in das Publikum: „Wie schätzen Sie den Pflanzenschutz in der Landwirtschaft in zehn Jahren ein?“ Hier sticht der Publikumsjoker ganz besonders. Die Antworten zeigen sehr hohe Übereinstimmung. Sowohl die Zuhörer als auch der Hohenheimer Professor erwarten, dass der chemische Pflanzenschutz noch weiter eingeschränkt wird und andere Arten, beispielsweise integrierter Pflanzenschutz, an Bedeutung gewinnen.
Den Fortschritt hält niemand auf
Bahrs erläutert die Arbeitszeitdegression am Beispiel der Milcherzeugung. Die Arbeitskraftstunden je Jahr nehmen mit wachsender Bestandsgröße ab. Wobei sich die Abnahmekurve allerdings in Großbeständen deutlich abflacht. Heute sind bereits Prototypen vollautomatisierter Melkkarusselle in der Anwendung. „Melken ohne Menschen“ bedeutet das. Die Wirkung technischer Fortschritte „kann niemand aufhalten“, ist Bahrs überzeugt.
Konflikte bei der Agrarproduktion
Allerdings können technische Fortschritte auch Konfliktpotenziale auslösen. Beispielsweise im Umwelt-, und Naturschutz. Sie können jedoch auch außerhalb der landwirtschaftlichen Produktion Fortschritte realisieren, beispielsweise beim Tierwohl.
Die Flächeninanspruchnahme durch nicht landwirtschaftliche Vorhaben gehört zu den hohen Konfliktpotenzialen. Die zunehmende Entfremdung der Bevölkerung von der Landwirtschaft und das damit verbundene geringere Verständnis für deren Besonderheiten stellt ein weiteres Konfliktpotenzial dar. Konflikte lösen bei Landwirten zudem Vorgaben des Lebensmitteleinzelhandels aus, insbesondere wenn diese restriktiver als die gesetzlichen Vorgaben sind. „Sie können die Flächenknappheit nicht ändern, Sie sollten sich damit arrangieren“, meint Bahrs.
Letztlich zwei Möglichkeiten
Letztlich sieht Bahrs für die Landwirte im Südwesten zwei Möglichkeiten.
- Erstens die Produktivität erhöhen und die Kosten minimieren.
Aber das sei angesichts der Strukturen in Baden-Württemberg und der dichten Besiedelung „fast nicht möglich“.
- Zweitens die Erhöhung der Erlöse. Hier sieht der Agrarökonom gerade in Metropolregionen in der Direktvermarktung Chancen. Zumal die Bevölkerung in Süddeutschland hohe Kaufkraft hat.
Allerdings liege nicht jedem der Kundenkontakt und das Verkaufen. Dazu müsse man Unternehmer sein, also auch das Persönlichkeitsprofil passen.
Eine Alternative liegt darin, die regionale Vermarktung in der Wertschöpfungskette mit starken Partnern zu realisieren, auch im Einzelhandel. Dazu sei es allerdings notwendig, aktiv auf Berufskollegen und den Handel zuzugehen, um dies gemeinsam zu gestalten.
Den technischen Fortschritt aufzunehmen, den Strukturwandel zu akzeptieren und geeignetes Vermarktungsumfeld zu erkennen – das empfiehlt der Agrarökonom mit seinem Fazit. Süddeutsche Betriebe seien vergleichsweise krisenfest und können wettbewerbsfähig sein, macht er Mut, dabei gebe es keine Patentrezepte. Vielmehr seien erfolgreiche Betriebsmodelle individuell angelegt. Dabei komme es darauf an, sich auf die eigenen Stärken und Interessen zu fokussieren und den Betrieb für den Nachwuchs attraktiv zu gestalten.
Nicht trauern, sondern gestalten
Mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr will sich Siegfried Nägele nicht lange aufhalten. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Esslingen hält sich an das alte indische Sprichwort: „Die gleiche Zeit, die es dauert, über die Vergangenheit zu trauern, hat man zur Verfügung, um die Zukunft zu gestalten.“ So verweist er auf die aktuellen Schwierigkeiten an vielen Märkten und die überwiegend angespannte Einkommenssituation auf den Höfen. Ernüchternd zeigt sich Nägele über den Landschaftserhaltungsverband, in den man große Hoffnungen zur Erhaltung der offenen Landschaft und Verringerung der Versiegelung gesetzt hatte. Bei der Reduzierung des Flächenverbrauchs tun sich alle politischen Ebenen von der Kommune bis zum Bund noch schwer, stellt der Vorsitzende fest. Er kritisiert, für die Region Stuttgart „ausschließlich Flächenlieferant für Flächennutzungsplanungen“ und Naherholungsgebiete zu sein. Es gelte zu erkennen, „dass wir nicht mehr so planen können wie vor 50 Jahren! Äcker sind nicht im Überfluss vorhanden“.
Sorge machten sich die Landwirte über den Änderungsentwurf für die EU-Verordnung für Biotreibstoffe, welcher beispielsweise den Rapsanbau deutlich reduzieren würde. Dadurch würden dessen positive Wirkungen der Fruchtfolge wegfallen und Rapskuchen als heimisches Eiweiß zur Fütterung fehlen.
Die Änderungen im Greening seien ein weiteres Ärgernis der EU-Kommission. Das geplante Verbot von Pflanzenschutzmitteln und Düngung für Leguminosen auf ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) würde der Strategie zuwiderlaufen, zunehmend heimisches Eiweiß anzubauen, bedauert Nägele. Landwirtschaft unter den heutigen Produktionsstandards und Qualitäten bedürfe keiner Legitimation. Essen sei Grundbedürfnis. Der Vorsitzende erinnert an den 1. Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck (1815 bis 1898), der sagte: „Im Verfall der Landwirtschaft sehe ich eine der größten Gefahren für unseren staatlichen Verband.“
Vier Botschaften
In vier Botschaften fasst Nägele seine Ansprache beim Kreisbauerntag zusammen:
- Der Berufsstand wird konsequent an die Planungsvorhaben herangehen, um den einseitigen Umgang mit dem Flächenverbrauch zu verbessern.
- Gesundes und ausreichendes Essen ist Grund genug, sich „eine Landwirtschaft zu leisten“. Das ist existenzieller Grundbedarf.
- Überbordende Auflagenpolitik beschleunigt den Strukturwandel und belastet die Betriebe und damit ebenso die Kulturlandschaft.
- Sich im Bauernverband engagieren, heißt, seine Zukunft selbst mitzugestalten.
Autor: hk