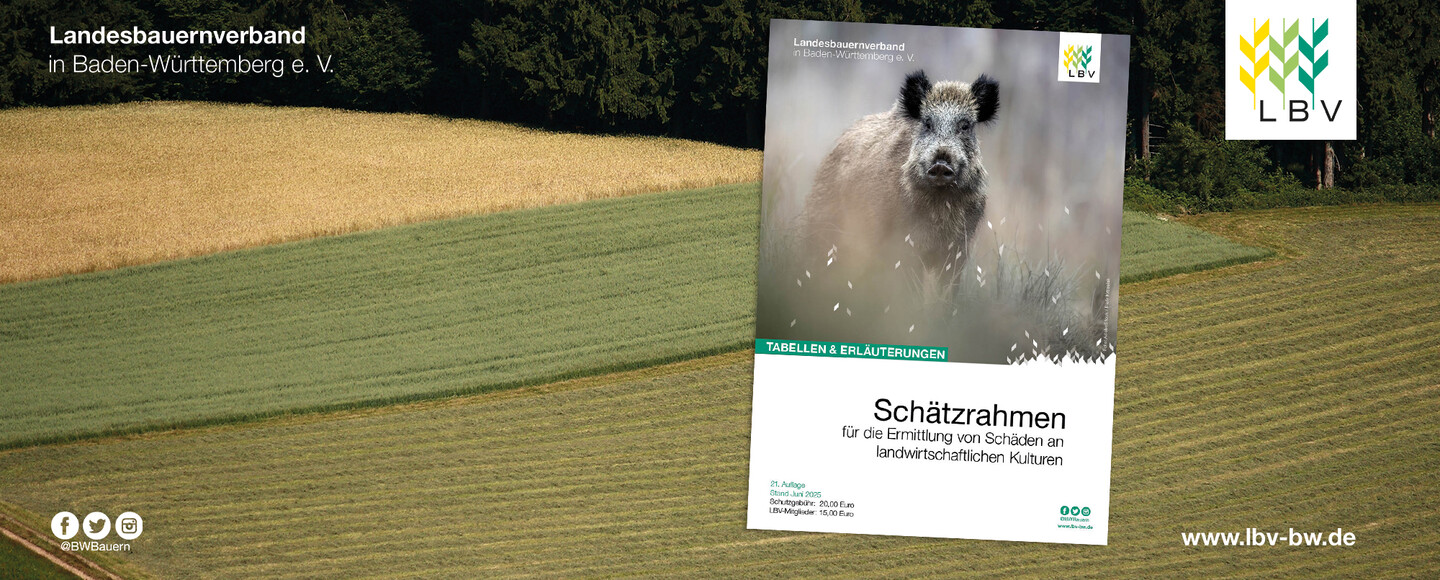MLR zu Regelungen Dauergrünland
Rückumwandlung von Dauergrünland
1. Umwandlung von Dauergrünland
Dauergrünland darf nur mit einer Genehmigung umgewandelt werden.
An die Genehmigung ist z. T. die Pflicht zur Anlage von Ersatzgrünland geknüpft. Ob die Pflicht zur Anlage von Ersatzgrünland im Einzelfall besteht, hängt maßgeblich von der einzelnen umzuwandelnden Fläche ab.
Genehmigungen (sowohl mit als auch ohne Pflicht zum Ersatz von Dauergrünland) können erteilt werden, solange der ermittelte Dauergrünlandanteil in Baden-Württemberg nicht um mehr als 5 Prozent im Vergleich zu dem Referenzanteil abgenommen hat (Art. 45 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 i.V.m. § 16 Absatz 4 und 5 DirektZahlDurchfG).
In Baden-Württemberg besteht durch die SchALVO seit 1988 sowie durch freiwillige vertragliche Verpflichtungen in MEKA und LPR seit 1992 und durch die Änderung des LLG seit 2011 ein weitgehender Dauergrünlandschutz. Eine Abnahme des Referenzanteils um mehr als 5 Prozent kann daher in Baden-Württemberg derzeit ausgeschlossen werden.
Ausblick: Dauer der Gültigkeit von erteilten Genehmigungen
Die Direktzahlungen-Durchführungsverordnung soll geändert werden. Im Entwurf der Änderungsverordnung ist die Einfügung eines neuen § 21 a vorgesehen, der die Regelung enthält, dass die Genehmigungen generell mit dem folgenden Schlusstermin für den Antrag auf Direktzahlungen enden. D. h. eine Genehmigung, die im Juli 2015 erteilt wurde, ist bis spätestens 15. Mai 2016 umzusetzen, ansonsten verfällt die Genehmigung (Ausnahme: Für Genehmigungen, die vor dem 15. Mai 2015 erteilt wurden, ist der maßgebliche Schlusstermin der 15. Mai 2016). Die Beschlussfassung im Bundesrat wird für Juli 2015 angestrebt (zweite Fassung zur Änderung der DirektZahlDurchfV.).
2. „Altes Dauergrünland“
Nach dem Direktzahlungen-Durchführungsgesetz ist zwischen „Dauergrünland“ und „neuem Dauergrünland“ zu unterscheiden.
- Zur besseren Verständlichkeit wird im Folgenden Dauergrünland, das bereits zum 31. Dezember 2014 bestanden hat, als sogenanntes „altes Dauergrünland“ bezeichnet.
- Ersatzgrünland, das verpflichtend im Zuge einer erteilten Umwandlungsgenehmigung angelegt werden musste, gilt ebenfalls ab dem ersten Tag als „altes Dauergrünland“.
Genehmigungen zur Umwandlung von „Altem Dauergrünland“ können in begründeten Einzelfällen erteilt werden. Diese Genehmigungen enthalten i. d. R. die Pflicht zur Anlage von Ersatzgrünland.
3. „Neues Dauergrünland“
Als „neues Dauergrünland“ wird das Dauergrünland bezeichnet, das am 31. Dezember 2014 noch nicht bestanden hat bzw. ab dem 1. Januar 2015 aufgrund der Auslegung der EU-Definition durch die EU-Kommission und den EuGH im Rahmen der Direktzahlungen aus
- bisherigem mehrjährigem Ackerfutteranbau oder
- mehrjährigen Bracheflächen oder
- der Anlage von Dauergrünland (freiwillig, kein Ersatzgrünland)
neu entsteht. (Siehe hierzu die beigefügte Anlage: MLR-Pressemitteilung).
Hinweis: Gemäß der EU-Definition bzw. der Auslegung durch den EuGH im Rahmen der Vorabentscheidung vom 2. Oktober 2014 ist bei einem mehrjährigen Ackerfutteranbau ein Anbau wechselnder Ackerfutterpflanzen irrelevant. Eine wechselnde Ackerfutternutzung durchbricht nicht die 5-Jahresregelung.
Soweit neues Dauergrünland entsteht, bedarf die Umwandlung zu einer anderen land- oder einer forstwirtschaftlichen Nutzung einer Genehmigung nach § 16 Abs. 3 DirektZahlDurchfG. Eine Umwandlungsgenehmigung, die neues Dauergrünland betrifft, beinhaltet nicht die Pflicht zur Anlage von Ersatzgrünland.
4. Bracheflächen als ökologische Vorrangflächen
Es bestehen nach wie vor Unklarheiten im Zusammenhang mit dem (Flächen-) Umfang der Anerkennung von Bracheflächen als ökologische Vorrangflächen (sog. ÖVF-Brache). Vor dem Hintergrund des von der EU vorgegebenen Grundsatzes, dass keine Umgehungen geschaffen werden dürfen, die dazu dienen, das Entstehen von Dauergrünland zu vermeiden, können nach derzeitigem Kenntnisstand als ÖVF-Brache codierte Flächen vermutlich nicht in beliebigem Umfang anerkannt werden. Allerdings gibt es für eine Beschränkung des Umfangs der anzuerkennenden ÖVF-Brachecodierung keine explizite Rechtsgrundlage.
Inwiefern eine ÖVF-Codierung von Brache über den notwendig zu erbringenden ÖVF-Umfang von 5 Prozent hinaus zulässig ist bzw. ab wann ggf. ein Umgehungstatbestand in Bezug auf Dauergrünland-Entstehung vorliegen könnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Das MLR setzt sich dafür ein, keine Begrenzung einzuführen, angestrebt wird eine schnelle Klärung.
Eine Anerkennung einer ÖVF-Brache wird nach jetzigem Kenntnisstand voraussichtlich grundsätzlich ausgeschlossen für:
- Betriebe, die an der Kleinerzeugerregelung teilnehmen;
- Betriebe, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ökologisch wirtschaften und nicht freiwillig am Greening teilnehmen.
(Hinweis: Die Teilnahme am Greening ist für diese Betriebe entsprechend im Gemeinsamen Antrag zu beantragen.)
Alle anderen Betriebe, die Direktzahlungen beantragen, können zwar grundsätzlich aus der Erzeugung genommene Ackerfläche als ÖVF-Brache codieren, der Umfang der anerkennbaren ÖVF-Brache ist aber noch fraglich.
Konsequenz:
- Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) derzeit, dass ausgehend von der zugrunde liegenden Fläche maximal 7 Prozent ÖVF-Brache beantragt werden sollten. Beim Umfang von 7 Prozent besteht ein in der Regel ausreichender Puffer, um bei den Greening-pflichtigen Betrieben die Erbringung von 5-Prozent ökologischer Vorrangflächen sicherzustellen.
- Unabhängig von der weiteren Entscheidung bei der ÖVF-Codierung wird aber darauf hingewiesen, dass auch Bracheflächen, die über den voraussichtlich maximal anzuerkennenden Flächenanteil von 7 Prozent hinausgehen (Vorschlag des BMEL), nicht endgültig ihren Ackerstatus verlieren. Es entsteht zwar zunächst neues Dauergrünland, das aber zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend Ziffer 3 umgewandelt werden kann. Demzufolge ist vor Antragstellung 2015 ein Umbruch mit nachfolgendem Anbau einer anderen Kultur (kein Gras oder sonstige Grünfutterpflanze) nicht erforderlich, um einen Ackerstatus langfristig zu sichern (Ziffer 5).
5. Aus der Erzeugung genommene Ackerflächen
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass auch jede zusätzliche als ÖVF deklarierte Brache auch allen Vorschriften und Nutzungsbeschränkungen einer ÖVF-Brache unterliegt. Bei aus der Erzeugung genommenen Ackerflächen (GlöZ-Flächen) entsteht gemäß der Auslegung der 5-Jahresregelung durch die EU-Kommission ab 2015 formal neues Dauergrünland. Dies war Deutschland und z. T. auch anderen Mitgliedstaaten bisher so nicht bekannt.
Kein neues Dauergrünland entsteht, sofern auf den Flächen
- eine jährliche Blühmischung oder Ähnliches ausgebracht wird;
- eine vertragliche Regelung gemäß Ziffer 6 und 7 besteht (aus der Erzeugung genommene Fläche, befristete Umwandlung zu Grünland, bestimmte Ackernutzung);
- die ÖVF-Brachecodierung anerkannt wird.
Das neu entstandene Dauergrünland kann später aber auf Antrag mit Genehmigung wieder in eine andere Nutzung (z.B. Acker) überführt werden, ohne dass Ersatzgrünland angelegt werden muss (vgl. Ziffer 3).
Im Direktzahlungen-Durchführungsgesetz gibt es diesbezüglich keine zeitliche Begrenzung, bis wann für eine ggf. gewünschte Rückumwandlung in Ackerland eine Genehmigung nach § 16 Absatz 3 DirektzahlDurchfG eingeholt werden muss.
D. h. für eine in 2015 entstandene neue Dauergrünlandfläche kann sowohl Ende 2015 als auch in den Folgejahren noch eine Genehmigung eingeholt werden, um dieses neue Dauergrünland in Ackerland ohne Anlage von Ersatzgrünland rückumwandeln zu können. Eine Genehmigung kann nicht ohne Rechtsgrund versagt werden.
Es besteht deshalb kein Grund, zur Sicherung des Ackerstatus kurzfristige Umbrüche durchzuführen und Ackerkulturen anzusäen (vgl. Ziffer 1).
6. Förderung im Rahmen der zweiten Säule (ELER-Förderung)
- LPR-Extensivierungsverträge, MEKA/FAKT-Brache
- Ackerflächen, die infolge eines LPR-Vertrages auf extensive Grünlandbewirtschaftung umgestellt wurden (Umwandlung zu Grünland)
Ackerflächen, die aufgrund einer ELER-Förderung zeitlich befristet aus der Erzeugung genommen sind bzw. für die eine definierte Ackerbewirtschaftung festgelegt wurde oder die vertraglich befristet als Grünland angelegt wurden, bleiben bis zum Vertragsende Ackerfläche.
Konsequenz:
- Eine an den Vertrag anschließende Ackernutzung bedarf keiner Genehmigung.
- Nach Vertragsende beginnt die 5-Jahresregelung zur Grünland-Definition.
o Als Erstansaatjahr zählt dabei das letzte Vertragsjahr.
o Wird nach Vertragsende die Fläche weiterhin aus der Erzeugung genommen (Brache) oder als Grünland genutzt, entsteht im sechsten Jahr nach Vertragsende Dauergrünland, sofern zwischenzeitlich keine Ackernutzung erfolgt ist.
o Sollte im sechsten Jahr Dauergrünland entstanden sein, gelten die Be-stimmungen für „neues Dauergrünland“ gemäß Ziffer 3.
Hinweis/Ergänzung:
Bereits bisher bestand zwischen Naturschutz-, Wasserwirtschaftswirtschaft- und Landwirtschaftsverwaltung Einvernehmen, dass ein vertraglich zugesicherter Vertrauensschutz fortzuführen ist.
Nach dem LLG ist eine Rückumwandlung innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach Auslaufen der Bewirtschaftungseinschränkung/vertraglichen Regelung möglich, sofern in den vertraglichen Vereinbarungen kein längerer Zeitraum festgesetzt ist.
D. h. auch nach den nationalen Vertrauensschutzregelung kann ggf. erst im sechsten Jahr neues Dauergrünland entstehen.
7. Kommunale Verträge oder vergleichbare Verträge im Rahmen des Grundwasserschutzes (u. a. Sanierungsverträge nach SchALVO)
Für diese Verträge bestehen keine entsprechenden rechtlichen Festlegungen, wie mit ihnen bzw. den zugrunde liegenden Flächen im Zusammenhang mit dem Greening umzugehen ist. Fehlende bundesrechtliche Regelungen sind aber nicht darauf zurückzuführen, dass der Bundesgesetzgeber wollte, dass diese vertraglichen Festlegungen außerhalb der zweiten Säule explizit ausgeschlossen werden sollen. Daher ist aus Sicht des MLR und des UM folgende analoge Handhabung anzuwenden:
Bei kommunalen Verträgen oder vergleichbaren Verträgen im Rahmen des Grundwasserschutzes, die Regelungen zu Ackerflächen enthalten,
- die aus der Erzeugung genommen sind,
- bestimmte Ackernutzungen (Gräser/Leguminosen etc.) festlegen oder
- eine zeitlich befristete Umwandlung in Grünland beinhalten,
gilt unabhängig von den Greeningregelungen im Rahmen der Direktzahlungen-Regelung ebenso der Vertrauensschutz für die zugesicherte ursprüngliche Ackernutzung nach Beendigung der Vertragslaufzeit.
Da kommunale Verträge oder vergleichbare Verträge im Rahmen des Grundwasserschutzes nicht zwangsläufig einen Verpflichtungsumfang von mindestens fünf Jahren umfassen, ist eine analoge Handhabung bei der Frage, wie die 5-Jahresregelung zur Dauergrünlandentstehung anzuwenden ist, nur bedingt möglich.
Konsequenz:
- Eine anschließende Ackernutzung im Folgejahr bedarf keiner Genehmigung, da die Fläche zum Vertragsende eine Ackerfläche bleibt.
- Sofern Verträge nahtlos ohne Unterbrechung für mindestens 5 Jahre durchgeführt werden (z. B. Fortführungsverträge bei einjährigen Verträgen etc.), gilt:
o Analog zu Ziffer 6 zählt das letzte Vertragsjahr als Erstansaatjahr.
o Wird nach Vertragsende die Fläche weiterhin aus der Erzeugung genommen (Brache) oder als Grünland genutzt, entsteht im sechsten Jahr nach Vertragsende Dauergrünland, sofern zwischenzeitlich keine Ackernutzung erfolgt ist.
o Sollte im sechsten Jahr Dauergrünland entstanden sein, gelten die Be-stimmungen für „neues Dauergrünland“ gemäß Ziffer 3.
- Sofern Verträge nicht nahtlos ohne Unterbrechung für mindestens 5 Jahre durchgeführt werden, werden bei Anwendung der 5-Jahresregelung zur Dauergrünland-Entstehung die unter Vertrag stehenden Jahre nicht berücksichtigt (d. h. diese Jahre werden wie „Pausejahre“ gewertet).
8. Egartwirtschaft
Inwiefern Egartwirtschaft auf Egartflächen innerhalb von FFH-Gebieten für Bezieher von Direktzahlungen weiterhin möglich ist, ist derzeit noch in Klärung.
(Baden Württemberg setzt sich beim Bund und der EU mit Nachdruck dafür ein, dass diese traditionelle Form der Mittelgebirgsbewirtschaftung erhalten werden kann).
9. Hinweise zum LLG
Alle o. g. Regelungen und Hinweise sind ausschließlich im Falle des Erhalts von EU-Direktzahlungen relevant. In Baden-Württemberg ist das Dauergrünlanderhaltungsgebot zu beachten.
Im Sinne des LLG werden im Jahr X+6 die Flächen zu Dauergrünland, die durchgehend und ohne Bodenbearbeitung mit derselben Ackerfutternutzung bewirtschaftet werden (vgl. Hinweise zum Vollzug vom 18.12.2012). Eine wechselnde Ackerfutternutzung führt im Sinne des LLG ausdrücklich nicht dazu, dass DG entsteht.
Die Regelungen des LLG werden im Laufe des Jahres 2015 geändert und angepasst, wonach sich die Regelungen des LLG dann auf „altes Dauergrünland“ im Sinne von Ziffer 2 beziehen sollen.
D. h. es soll über die derzeitige Förderperiode hinaus ein dauerhafter, flächendeckender und kontinuierlicher Schutz von Dauergrünland sichergestellt werden.
Mit obigen Ausführungen wird bestätigt, dass das MLR und das UM sich zu den bisherigen vertraglichen Verpflichtungen bekennen und diese mit Blick auf die Erhaltung des Dauergrünlands und das freiwillige Engagement der Landwirte für eine umweltverträgliche und ökologische Landbewirtschaftung auch für die Zukunft zusichern. Die Erhaltung der Kulturlandschaft und die Vermeidung umweltschädlicher Eingriffe sollen sichergestellt werden. Die Landesregierung wird sich weiterhin für sachgerechte und faire Regelungen zur Dauergrünlanderhaltung aber auch zur Sicherung des Ackerstatus von Vertrags- und ökologischen Vorrangflächen und insbesondere zur Vermeidung von negativen - auch von den Landwirten nicht gewollten - Umwelteffekten auf Bundes- und EU-Ebene einsetzen.
Autor: Joachim Hauck, Wolfgang Bauer und Dr. Gerhard Spilok, Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg